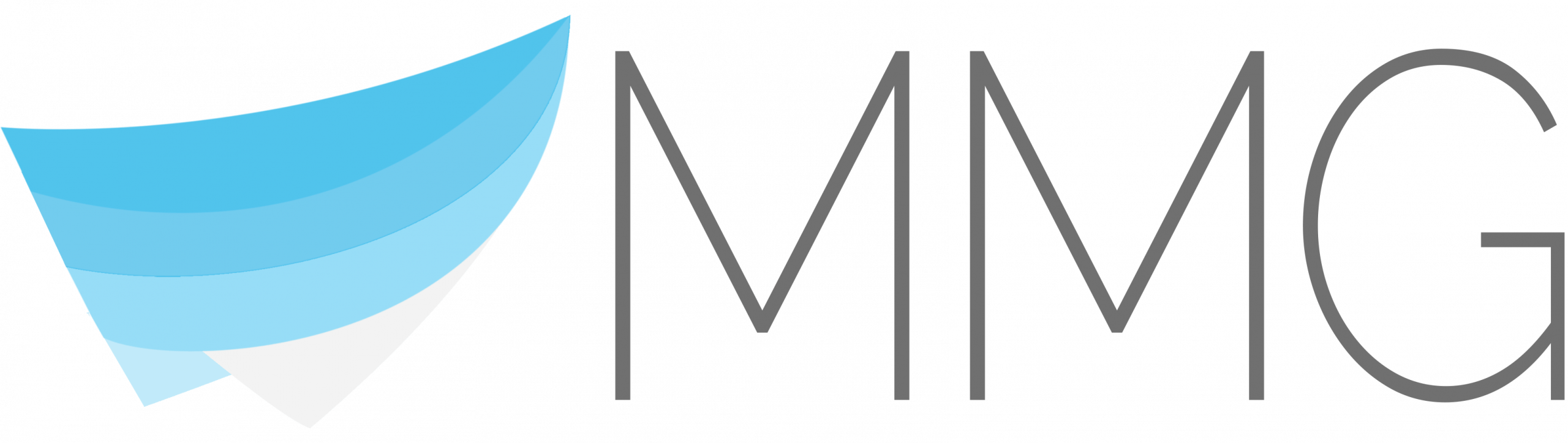Verification of Payee (VoP)
Verification of Payee: Das müssen Sie im Treasury wissen
VoP ist in aller Munde. Als Bestandteil der Instant Payments Regulation (IPR) sind ab dem 9. Oktober 2025 alle Banken im Euroraum verpflichtet, für alle SEPA-Zahlungen zu überprüfen, ob die IBAN und der Name des Begünstigten übereinstimmen. Das gilt sowohl für SEPA-Standardüberweisungen als auch für die SEPA Instant Credit Transfers. Eilüberweisungen sind von der Prüfung ausgenommen.
Strategien auf Seite des Zahlenden: Stabile Prozessabläufe sicherstellen und manuelle Eingriffe auf ein Minimum reduzieren
1) Vermeidungsstrategie: Opt-Out, Eilzahlungen & Sammelbuchungen
Ein von vielen Unternehmen geplanter Workaround, ist es die „Opt-Out“ Variante zu wählen und damit die VoP-Prüfung der Banken „abzuwählen“. Aber: Das Opt-Out ist nur möglich für Sammelzahlungen. Eilzahlungen sind von der VoP ohnehin ausgenommen. Für Einzelzahlungen, die nicht als Eilzahlungen deklariert sind oder für Instant Payments ist die Opt-Out-Variante aber nicht möglich.
Die BaFin hat angekündigt, es vorerst nicht zu beanstanden, wenn Banken – abweichend von der EU-Richtlinie – das Opt-Out auch für Einzelzahlungen anbieten. Wie lange diese Ausnahmeregelung Bestand haben wird und ob alle Banken sie anwenden, ist jedoch unklar.

Aber auch für Einzelzahlungen gibt es Möglichkeiten zur Vermeidung der VoP:
- Bündelung von Einzelzahlungen vor dem Versand an die Bank. Dadurch entsteht eine Sammelzahlung, bei der Opt-Out genutzt werden kann. Für SAP APM (Advanced Payment Management) haben wir bereits eine automatisierte Lösung implementiert.
- Versand aller Einzelzahlungen als Eilzahlungen. Dabei sind jedoch die höheren Kosten zu berücksichtigen.
Nachteile der Vermeidungsstrategie ist, dass sie den Sicherheitsgedanken der VoP unterläuft. Die VoP kann dazu beitragen, Betrugsfälle zu verhindern.
Mögliche Betrugsfälle, die über VoP verhindert werden sind z.B. folgende:
- Bei der Lieferantenanlage gibt die Kontaktperson Ihres Lieferanten statt der IBAN des Unternehmens seine eigene IBAN an.
- Ein Betrüger könnte Ihnen ein gefälschtes Dokument zusenden, auf dem steht, dass sich die Kontoverbindung des Lieferanten geändert hat und darin seine eigene IBAN angeben.
2) Strategien für Unternehmen, die VoP nutzen wollen: Wie kann man VoP proaktiv in den Prozessen etablieren?
Wer sich dem Thema Verification of Payee (VoP) bereits heute proaktiv stellen möchte, steht vor Herausforderungen. Viele Systemlösungen – und teilweise auch die Banken – sind derzeit noch nicht in der Lage, den VoP-Prozess vollumfänglich und automatisiert abzubilden. Dennoch bieten auch die bestehenden Lösungen bereits Ansatzpunkte.
Zunächst betrachten wir, wie sich VoP-Rückmeldungen verarbeiten lassen. Anschließend werfen wir einen Blick auf Strategien, mit denen sich Fehlschläge bei VoP-Prüfungen möglichst vermeiden lassen.
Effizienter Umgang mit VoP-Ergebnissen
Der Zahlungsträger wird im ersten Schritt an die Bank übermittelt, welche die VoP-Prüfung durchführt. Das Ergebnis dieser Prüfung wird in Form einer pain.002-Datei zurückgesendet.
pain.002-Nachrichten sind bereits als Zahlungsstatusmeldungen bekannt und werden in vielen Unternehmen genutzt, um auf Einzelpostenebene Informationen darüber zu erhalten, welche Zahlungen ausgeführt wurden und welche nicht. Für VoP-Rückmeldungen ist die neueste Version pain.002.001.10 vorgesehen.
Nach dem Eingang der pain.002-Nachricht gilt es, das Ergebnis der VoP-Prüfung möglichst automatisiert auszuwerten. SAP plant, die Ergebnisse künftig durch einen speziellen Status in den Apps „Monitor Payments“ und „Manage Payments“ erkennbar zu machen.
Diese Lösung ist bislang jedoch noch nicht umgesetzt und wird zunächst ausschließlich für die Cloud-Versionen von SAP bereitgestellt.
Um sicherzustellen, dass unseren Kunden bereits zum Go-Live der VoP-Richtlinie ein Monitor zur Verfügung steht, der die VoP-Ergebnisse in Echtzeit anzeigt, arbeiten wir bei MMG bereits an einer eigenen Lösung. In einer weiteren Ausbaustufe könnte dieser Monitor nicht nur die Ergebnisse darstellen, sondern auch direkt ermöglichen, Kreditorenstammdaten anzupassen oder die notwendige Korrespondenz an Lieferanten auszulösen.
Nach der Auswertung der VoP-Ergebnisse sieht der Prozess vor, eine zweite Autorisierung an die Banken zu senden. Wird der EBICS-Kanal genutzt, ist hierfür die Funktion VEU (Verteilte Elektronische Unterschrift) vorgesehen. Da die VEU in der Praxis bislang jedoch nur selten eingesetzt wird, wird sie von vielen Bankkommunikationslösungen nur eingeschränkt unterstützt und verursacht zusätzlichen manuellen Aufwand. Für andere Bankkommunikationskanäle existiert derzeit keine standardisierte Lösung, um die zweite Autorisierung nach der VoP-Prüfung zu übermitteln.
Im Juli 2025 hat die Europäische Kommission eine zentrale Klarstellung zur praktischen Umsetzung der IPR veröffentlicht. Demnach können Unternehmen mit ihren Banken vertraglich vereinbaren, dass Zahlungsaufträge aus Sammelüberweisungen – abhängig vom VoP-Ergebnis – automatisch ausgeführt oder abgelehnt werden, ohne dass eine erneute Autorisierung erforderlich ist.
Dank dieser Anpassung können Unternehmen auch ohne Nutzung der VEU-Funktion einen effizienten VoP-Prozess implementieren:
- Zahlungsdateien mit ausschließlich „Match“-Ergebnissen werden automatisch von den Banken ausgeführt.
- Unternehmen, die SAP-Module wie Bank Communication Management (BCM) oder Advanced Payment Management (APM) nutzen, können für Zahlungsdateien, die aufgrund von „No-Matches“ vollständig abgelehnt wurden, eine automatisierte Neuerstellung anstoßen – entweder ohne die kritischen Zahlungen oder nach deren Korrektur im Rahmen eines Workflows.
Proaktive Maßnahmen, um positive VoP-Rückmeldungen zu erhalten
Stammdatenqualität: Prüfung der Lieferantenstammdaten
Der wichtigste Hebel proaktiver Maßnahmen sind saubere und regelmäßig geprüfte Stammdaten.
Dafür gibt es vier mögliche Ansätze:
- Nutzung eines zentralen Stammdatenregisters
- Bilaterale Abfrage der Stammdaten bei den einzelnen Lieferanten
- Nutzung von Banken-APIs für eine Vorab-VoP-Prüfung
- Flächendeckende Penny-Tests , bei denen die VoP-Prüfung als „Stammdatenregister“ genutzt wird.
Zunächst betrachten wir, wie sich VoP-Rückmeldungen verarbeiten lassen. Anschließend werfen wir einen Blick auf Strategien, mit denen sich Fehlschläge bei VoP-Prüfungen möglichst vermeiden lassen.
Zentrales Stammdatenregister
Bei einem zentralen Stammdatenregister können auf Basis von eindeutigen Identifikationsnummern oder Namensabfragen Informationen eingeholt werden. Zunächst stellt sich die Frage, auf Basis welcher ID die Anfrage bei so einem Register abläuft. Am einfachsten funktioniert die Anfrage über eine eindeutige ID wie die LEI (Legal Entity Identifier) oder weitere IDs (D&B ID, BvD ID etc). Diese können im SAP-Geschäftspartnerstamm hinterlegt werden.
Die meisten Unternehmen verwenden aktuell jedoch noch keine LEIs in ihren Stammdaten, obwohl diese gerade im ISO20022-Umfeld ein sinnvolles Mittel zur Erhöhung der Zahlungssicherheit darstellen: Denn Banken sind verpflichtet, eine LEI zu prüfen, sofern diese in der Zahlung übermittelt wird.
Mit einer eindeutigen ID können APIs von Stammdatenanbieter wie z.B. Orbis, Northdata oder Creditsafe angesprochen werden, um dann zu prüfen, ob der aktuell im SAP-System hinterlegte Firmenname auch zur LEI passt. Wenn keine eindeutige ID vorhanden ist, kann mittels Firmennamen gesucht werden, ob es diese in der Datenbank der Stammdatenanbieter gibt. Ist das nicht der Fall, liegt es nahe, dass auch eine VoP-Prüfung negativ ausfallen würde.
Verlässliche Anbieter zur Stammdatenverifikation:
- Orbis – Handelsregister-Daten
- Northdata – Umfirmierungs- & Beteiligungshistorie
- Creditsafe – Bonitäts- und Adressprüfung
- Firmenwissen.de / Wer-zu-wem.de – Branchen- & Eigentümerinfos
- LEI- & GLN-Register – für internationale Prüfungen
Bilaterale Stammdatenprüfung mit den Lieferanten
Neben der Variante, die Stammdatenqualität über ein zentrales Repository sicherzustellen, wäre es natürlich auch möglich, sich die Informationen bilateral von allen Lieferanten geben zu lassen. Hier wäre ein Schreiben in folgender Form möglich: „Sehr geehrte Damen und Herren, wir bereiten uns aktuell auf die zum 09. Oktober in Kraft tretende Verification of Payee vor. Hierfür ist es erforderlich, dass wir die aktuell bei uns hinterlegten Stammdaten (Firmenname und IBAN) prüfen. Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung, ob die bei uns gespeicherten Daten weiterhin aktuell sind.
Flächendeckende Penny-Tests und damit Nutzen der VoP-Prüfung als „Stammdatenregister“
Penny-Tests kennen wir im Zahlungsverkehr als Methode, um vor einem Go-Live über jede angebundene Hausbank einen einzelnen Cent-Betrag zu überweisen. So wird sichergestellt, dass die Anbindung funktioniert, bevor große Zahldateien übermittelt werden.
Im Rahmen der VoP-Prüfung lassen sich Penny-Tests ebenfalls sinnvoll nutzen. Mit Inkrafttreten der VoP-Richtlinie können zunächst für alle Lieferanten Penny-Tests durchgeführt werden. Die Ergebnisse ermöglichen eine Analyse und die Anpassung fehlerhafter Stammdaten, sodass die Prozesse vorbereitet sind, bevor die ersten „echten“ Zahlungen erfolgen.
Für die effiziente Durchführung solcher massenhaften Penny-Tests ist allerdings eine Automatisierung erforderlich. Wir bei MMG arbeiten bereits an einer Lösung, die für alle aktiven Kreditoren (z. B. für diejenigen, an die in den letzten 12 Monaten Zahlungen erfolgt sind) automatisch Zahlungsanordnungen erstellt, die anschließend in einem regulären Zahllauf verarbeitet werden können. Die Ergebnisse werden in einem Monitor visualisiert und bilden die Grundlage für die gezielte Anpassung der Stammdaten.
Da die Durchführung von Penny-Tests eine einmalige Maßnahme darstellt führt jedoch kein Weg daran vorbei, Prozesse zu etablieren, die eine hohe Stammdatenqualität sicherstellen
Strategien für Zahlungsempfänger: verspätete Zahlungseingänge vermeiden
Was in den aktuellen Diskussionen meist weniger betrachtet wird, ist die Perspektive des Zahlungsempfängers. Natürlich stellt VoP in erster Linie eine Herausforderung für die Prozesse des Zahlenden dar. Kommt es jedoch auf dessen Seite zu Problemen und damit zu verzögerten Zahlungen, hat dies aus Sicht der Liquidität negative Konsequenzen für die andere Partei: Nicht der Sender, sondern der Empfänger trägt den Schmerz, da er auf den Geldeingang warten muss.
Daraus folgt: Auch der Zahlungsempfänger hat ein ureigenes Interesse daran, dass Zahlungen an ihn nicht durch die VoP-Prüfung aufgehalten werden.
Mit den folgenden Maßnahmen können Zahlungsempfänger aktiv VoP-Probleme vermeiden:
Mappinglisten bei Umfirmierungen:
- Die VoP-Prüfung schlägt fehl, wenn der in der Zahlung angegebene Name nicht zur IBAN passt. Ein häufiger Grund hierfür sind Umfirmierungen des Zahlungsempfängers. Werden die Stammdaten beim Geschäftspartner nicht aktualisiert, wird weiterhin der alte Name in den Zahlungen übermittelt.
- Einige Banken bieten in solchen Fällen die Möglichkeit, eine Mappingliste zu pflegen, die bei der VoP-Prüfung berücksichtigt wird. Unternehmen, die sich in den letzten Jahren umfirmiert haben, sollten daher mit ihren Banken sprechen und sicherstellen, dass die Umfirmierung in der Mappingtabelle erfasst ist.
Ebenso wäre bei Umfirmierungen in den letzten Jahren eine Information an die Kunden sinnvoll. Ein Text kann z.B. wie folgt aussehen „Im Oktober 2025“ tritt die VoP-Richtlinie in Kraft. Wir haben uns (wie Ihnen im Jahr 202X bereits kommuniziert – falls dies der Fall war) Anbei senden wir Ihnen unsere aktuellen Lieferantenstammdaten erneut. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Stammdaten bei Ihnen in den Systemen entsprechend gepflegt sind, und in Zahlungsdateien so hinterlegt werden.
Auch wenn keine Umfirmierung erfolgt ist, kann es vorkommen, dass Stammdaten beim Kunden fehlerhaft erfasst sind (z. B. durch eine fehlerhafte Erstanlage oder versehentliche Änderungen). Daher ist es auch in diesem Fall sinnvoll, Kunden proaktiv zu informieren, etwa mit folgendem Text:
„Im Oktober 2025 tritt die VoP-Richtlinie in Kraft. Anbei senden wir Ihnen unsere aktuellen Lieferantenstammdaten. Bitte stellen Sie sicher, dass diese in Ihren Systemen korrekt gepflegt sind und in den Zahlungsdateien entsprechend hinterlegt werden.“
Ergänzend kann in Ihrem SAP-System eine Prüfung durchgeführt werden, welche Zahlungseingänge zwar an Ihre IBAN adressiert waren, jedoch mit einem abweichenden Empfängernamen. Diese Kunden können Sie gezielt anschreiben und auf die notwendige Stammdatenkorrektur hinweisen.